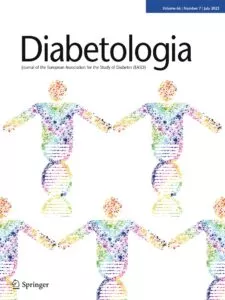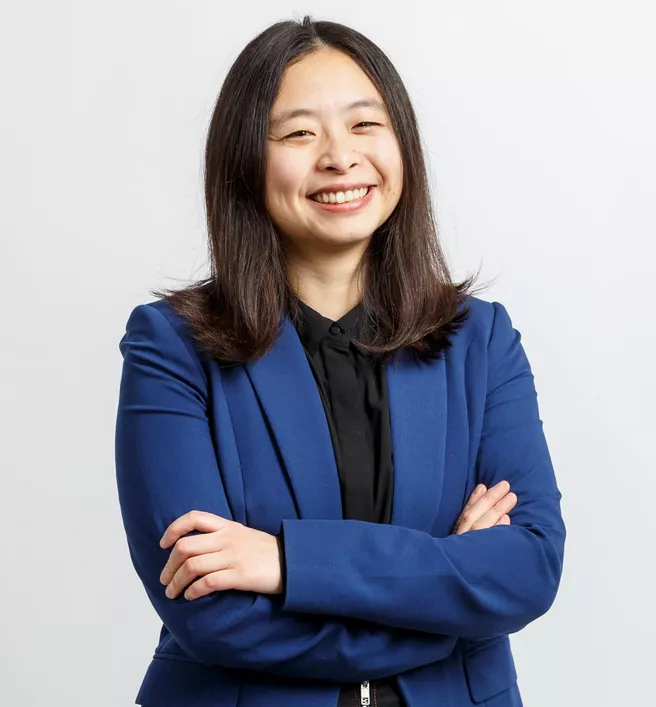In Deutschland leiden laut Bundesministerium für Gesundheit (BMG) circa 7,2 Prozent der Erwachsenen im Alter von 18 bis 79 Jahren an Diabetes mellitus. 90 bis 95 Prozent davon sind an Typ-2-Diabetes erkrankt. Er entsteht zum einen durch eine verminderte Empfindlichkeit der Körperzellen für Insulin (Insulinresistenz), zum anderen führt eine jahrelange Überproduktion von Insulin zu einer „Erschöpfung“ der insulinproduzierenden Zellen, weshalb die Bauchspeicheldrüse nicht genügend Insulin für den erhöhten Bedarf liefern kann. Neben einer erblichen Veranlagung gelten Übergewicht und Bewegungsmangel als die wichtigsten Verursacher eines Typ-2-Diabetes.
Die Kosten für das routinemäßige Diabetes-Management oder auch die Behandlung von Diabetes-Komplikationen stellen zum einen eine erhebliche gesundheitliche Belastung für Patient_innen, zum anderen aber auch eine wirtschaftliche Belastung für Gesundheitssysteme und Gesellschaften dar. Die Professur für Public Health und Prävention unter der Leitung von Prof. Dr. Michael Laxy hat daher im Rahmen einer Studie versucht, die langfristigen gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen einer verbesserten Risikofaktorenkontrolle bei deutschen Erwachsenen mit Typ-2-Diabetes abzuschätzen. Die Ergebnisse wurden nun unter dem Titel „Health and economic impact of improved glucose, BP and lipid control among German adults with type 2 diabetes: a modelling study“ im Journal „Diabetologia“ veröffenticht. Die Fachzeitschrift hat einen Impact Faktor von 10,460.
„Patient_innen mit Typ-2-Diabetes sind leider oftmals nicht optimal eingestellt, wenn man sich die Risikofaktoren ansieht“, sagt Min Fan, Erstautorin der Studie und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur für Public Health und Prävention. „Dazu gehören die Blutzuckereinstellung sowie die Einstellung von Blutdruck und den Lipiden. Die verschiedenen Fachgesellschaften sprechen hier Empfehlungen aus, in welchem Bereich Grenzwerte liegen oder welche Ziele eingehalten werden sollten. Wir haben uns in der Studie angesehen, was passieren würde, wenn alle Patient_innen bestimmte Therapieziele für diese Risikofaktoren, wie in Leitlinien empfohlen, erreichen würden.“
Anhand des UK Prospective Diabetes Study Outcome Model 2 (UKPDS-OM2) wurden Gesundheitsergebnisse und Versorgungskosten im Gesundheitssystem von Menschen mit Typ-2-Diabetes in Deutschland über die Zeiträume von fünf, zehn sowie 30 Jahren berechnet. Die modellierten Szenarien waren eine dauerhafte Senkung des HbA1c-Wertes, der beschreibt, wie hoch der Blutzucker in den letzten acht bis zwölf Wochen war, des systolischen Blutdrucks sowie des LDL-Cholesterins.
„Wir haben versucht, zu analysieren, welche gesundheitlichen Auswirkungen die Erreichung bestimmter Therapiezielen für Risikofaktoren auf Populationsebene hätte“, erklärt Prof. Laxy. „Der Endparameter, den wir uns angesehen haben, ist die qualitätsadjustierte Lebenszeit. Dieser setzt sich aus der Lebensqualität und der Lebensdauer von Personen zusammen. Zudem haben wir berechnet, welche ökonomischen Implikationen eine leitliniengerechte Einstellung innerhalb vom Gesundheitssystem im Hinblick auf Kosten für ambulante und stationäre Versorgung, Medikation usw. hätte.“
Die Forschenden fanden heraus, dass die dauerhafte Erreichung eines Zielwertes von unter 7% für HbA1c, von unter 140 mmHg für den systolischen Blutdruck und von unter ≤2.6 mmol/l für LDL-Cholesterin für alle Personen mit Typ-2-Diabetes in Deutschland zu erheblichen Kosteneinsparungen und Zugewinnen an qualitätsadjustierter Lebenszeit führen würde. Auf nationaler Ebene könnten damit die Versorgungskosten im Zeitraum von zehn Jahren um mehr als 1,9 Milliarden Euro reduziert werden. Insofern würden nachhaltige Verbesserungen bei Diabetes-Patient_innen in Deutschland zu einem erheblichen gesundheitlichen Nutzen führen und die Ausgaben im Gesundheitswesen deutlich mindern.
„Es handelt sich hierbei um eine gesundheitsökonomische Modellierung mit bestimmten Annahmen“, ordnet Prof. Laxy die Ergebnisse relativierend ein. „Wenn ich die betroffenen Personen von Vornherein besser versorgen will, was langfristig zu einer Kostenersparnis führen kann, müssen natürlich auch mehr Ressourcen für Therapie und Management eingesetzt werden. Diese Investitionen für bessere oder intensivere Prävention und Versorgung haben wir in unserer Studie nicht berücksichtigt.“
Der erwartete langfristige gesundheitliche und wirtschaftliche Nutzen, der im Zuge der Studie analysiert wurde, kann deutschen Entscheidungsträger_innen im nächsten Schritt nun dabei helfen, Interventionen und Therapieoptionen unter dem Gesichtspunkt der Effizienz zu bewerten.
Zur Publikation „Health and economic impact of improved glucose, BP and lipid control among German adults with type 2 diabetes: a modelling study“ im Journal „Diabetologia“
Zur Homepage der Professur für Public Health und Prävention
Kontakt:
Prof. Dr. Michael Laxy
Professur für Public Health und Prävention
Georg-Brauchle-Ring 60/62
80992 München
Tel.: 089 289 24977
E-Mail: michael.laxy(at)tum.de
Min Fan
Professur für Public Health und Prävention
Georg-Brauchle-Ring 60/62
80992 München
Tel.: 089 289 24982
E-Mail: min.fan(at)tum.de
Text: Romy Schwaiger
Fotos: “Diabetologia”/privat