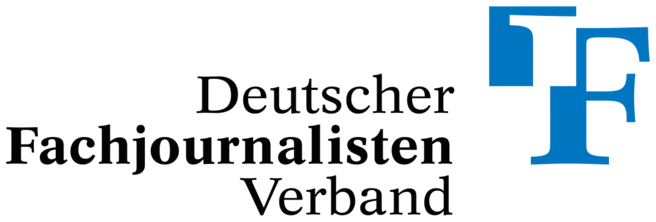Doping ist ein konstantes und wichtiges Thema im Sportjournalismus, erfüllt es doch gleich drei Nachrichtenfaktoren: Negativismus, Skandalisierung und Personalisierung. Zunehmend verlagert sich der Fokus jedoch von den Athletinnen und Athleten als Einzeltäterinnen und Einzeltäter auf das dahinterliegende System und verschiedene mitverantwortliche Akteurinnen und Akteure. Doping wird damit als „Konstellationseffekt“ betrachtet – eine Perspektive, die auch der Sportjournalismus sukzessive einnimmt. Damit rücken die Coaches, die den engsten Kontakt zu den Athletinnen und Athleten haben, stärker ins Blickfeld der Dopingberichterstattung.
Vor diesem Hintergrund haben Prof. Dr. Michael Schaffrath, Leiter des Arbeitsbereichs Medien und Kommunikation, und Dr. Thorsten Schulz vom Lehrstuhl für Präventive Pädiatrie im November 2024 im Magazin „Fachjournalist“ des Deutschen Fachjournalisten-Verbands den Artikel „Sportjournalismus: Nur dabei statt mittendrin. Meinungen von Trainer*innen zur Dopingberichterstattung sowie zur Kompetenz und Mitverantwortung beim Thema Doping. Eine Studie der TU München“ veröffentlicht. Der Fachartikel fasst einige ausgewählte Befunde der Studie „Trainer und Medien: Eine Analyse zur Wahrnehmung und Bewertung der Dopingberichterstattung und die Auswirkung auf die Trainingsarbeit“ (TuMDoBe) aus dem Jahr 2022 zusammen. Zentrale Fragestellungen waren, wie Trainerinnen und Trainer die Dopingberichterstattung von Sportjournalistinnen und Sportjournalisten wahrnehmen und welche Kompetenz und Mitverantwortung sie diesen in Bezug auf das Thema Doping zuschreiben.
An der Befragung nahmen 822 Trainerinnen und Trainer vom National- bis zum C-Kader teil. Aus den Ergebnissen geht hervor, dass unter den Coaches überwiegend großes Interesse an der Dopingberichterstattung besteht. Gleichzeitig kritisieren jedoch fast 60 Prozent, dass die Medien eine Mitschuld am Doping tragen. Drei Viertel der Befragten wünschen sich, stärker in die Dopingberichterstattung einbezogen zu werden, die von 50 Prozent der Coaches als „vorurteilbehaftet“ bezeichnet wird. Während fast 30 Prozent der Trainerinnen und Trainer den Sportjournalistinnen und Sportjournalisten mäßige bis große journalistische Kompetenz, auch in Bezug auf Doping, zusprechen, erachten gleichzeitig nur 8,1 Prozent die Journalisten als fähig, ihre Arbeit als Trainer zu beurteilen. Trotz dieser Kritik sehen die Trainerinnen und Trainer die Hauptverantwortung für Doping nicht bei den Medien, sondern bei den Athletinnen und Athleten selbst. Ihre eigene Mitverantwortung schätzen sie zudem höher ein als die der Sportjournalistinnen und Sportjournalisten.
Die Studie zeigt, dass den Journalistinnen und Journalisten durchaus eine mittelbare Verantwortung am Doping im Leistungssport zugewiesen wird, die aber vor allem auf dem durch die Medien aufgebauten Erfolgsdruck rekurriert. Dies legt die Empfehlung nahe, dass Sportjournalistinnen und Sportjournalisten sowohl ihre eigene Mitverantwortung verstärkt reflektieren als auch die Verantwortung anderer Akteure vermehrt in die Berichterstattung einbeziehen sollten. Anknüpfend an die Trainer*innen-Studie werden in einer aktuellen Untersuchung unter der Leitung von Prof. Dr. Schaffrath und Dr. Thorsten Schulz Spitzensportlerinnen und Spitzensportler zu ihrer Wahrnehmung der medialen Dopingberichterstattung befragt.
Hier geht es zur TuMDoBe-Studie
Hier geht es zum Artikel im „Fachjournalist“
Text: Jasmin Schol
Foto: Deutscher Fachjournalisten-Verband/Pixabay/privat