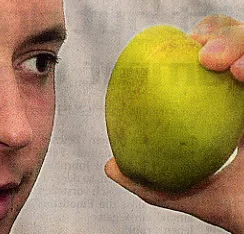Fitness-Claims auf Verpackungen
Ein Blick in Supermarktregale zeigt, dass viele Lebensmittelmarken Wörter wie „fit“, „aktiv“ oder „Sport“ in den Produktbezeichnungen verwenden und häufig sportliche Werbeträger auf ihren Produkten abbilden. Fragt man Konsumenten explizit, ob sie von solchen Slogans beeinflusst werden, verneinen sie dies in der Regel. Eine jüngst veröffentlichte Studie zeigt jedoch, dass Konsumenten sich durchaus von solchen Claims leiten lassen. Die Studie hatte zwei Ziele:
- Erstens, den durch Fitness-Claims verursachten Mehrkonsum zu quantifizieren
- Zweitens, den Mechanismus offenzulegen, der für diesen Effekt verantwortlich ist
Die Studien
Zwei Studien manipulierten die Bezeichnung eines Lebensmittels (Studentenfutter): In einer Experimentalgruppe bekamen die Versuchspersonen die Gelegenheit, ein Fitness-Studentenfutter zu verköstigen, in der zweiten Experimentalgruppe wurde das identische Lebensmittel ohne zusätzliche Fitnessbezeichnung zum Konsum zur Verfügung gestellt. Den Versuchspersonen war das Ziel der Studie nicht bewusst.
Der trügerische Fitness-Effekt
Nachdem die von den Versuchspersonen abgefüllten Portionsgrößen und Konsummengen erfasst wurden, fand ein Vergleich der Experimentalgruppen statt: Obwohl sich die Personen nicht in ihrem wahrgenommenen Appetit unterschieden, füllten sich Personen, die das Fitness-Studentenfutter aßen, bis zu 50% mehr ab als Personen aus der Vergleichsgruppe. Der Konsum stieg um ebendiese prozentuale Größe an und lag weit über der als objektive Portionsgröße festgehaltenen Norm (in Höhe von 30 Gramm). Und das trügerische daran ist: Personen aus der Gruppe des Fitness-Studentenfutters nahmen geringere Schuldgefühle wahr und schätzten sich näher an ihrem Fitnessideal ein – trotz (oder gerade wegen) des Mehrkonsums!
Was können Konsumenten tun?
Konsumenten sollten sich der Tatsache bewusst sein, dass Behauptungen (wie z.B. Fitness, wenig Fett, vitaminreich) nicht zwangsläufig mit geringem Kaloriengehalt einhergehen. Solange Konsumenten keine Bestrebungen haben, ihr Körpergewicht zu reduzieren, sollte der Mehrkonsum keinen Zielkonflikt bewirken. Streben sie jedoch danach, weniger Kalorien zu sich zu nehmen, können solche Produkte gegenteilige Effekte haben und Konsumenten dazu veranlassen, „sich auf der sicheren Seite“ zu fühlen, obwohl tatsächlich ein Mehrkonsum eintritt, der die Kalorienbilanz in Richtung eines Überschusses beeinflusst.
Kontakt:
Prof. Dr. Jörg Königstorfer
Uptown München Campus D
Georg-Brauchle-Ring 60/62
80992 München
Tel.: +49.89.289.24559
Fax: +49.89.289.24642
info.mgt(at)sg.tum.de