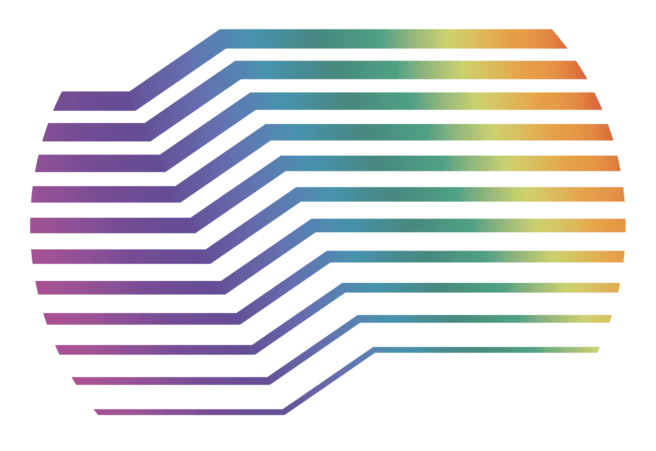Licht ist mehr als nur ein Mittel zur visuellen Orientierung – es ist ein zentrales Steuerungssignal für unsere innere Uhr. Es beeinflusst, wann wir müde werden, wie Hormone im Körper produziert werden und wie leistungsfähig oder ausgeglichen wir uns fühlen. Trotz seiner fundamentalen Wirkung auf unsere Gesundheit wird Licht im medizinischen und gesellschaftlichen Kontext noch immer unterschätzt. Mit der internationalen Initiative „Light for Public Health“ soll sich das nun ändern: am 16. Mai 2025, dem UNESCO International Day of Light, startete die neue Initiative mit dem Ziel, evidenzbasiertes Wissen über gesundheitsrelevante Lichtwirkungen weltweit zugänglich zu machen.
Die Initiative geht aus einer interdisziplinären Fachkonferenz hervor, die im April 2024 im Rahmen des Ladenburger Diskurses „Licht für Gesundheit und Wohlbefinden“ stattfand. Dort kamen internationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammen, um aktuelle Erkenntnisse zur biologischen Wirkung von Licht zusammenzutragen. Das Resultat ist ein gemeinsames Konsenspapier mit 26 wissenschaftlich abgestimmten Kernaussagen, den sogenannten „Consensus Statements“.
„Licht wirkt tief in unsere Biologie hinein – weit über das Sehen hinaus“, sagt Prof. Dr. Manuel Spitschan, Leiter der Professur für Chronobiology and Health und Mitorganisator der Initiative. „Es beeinflusst Prozesse wie Schlaf, Hormonregulation und mentale Leistungsfähigkeit – und zwar in Abhängigkeit von Zeitpunkt, Intensität und spektraler Zusammensetzung.“ Während natürliches Morgenlicht als besonders förderlich gilt, kann künstliches, helles Licht am Abend den zirkadianen Rhythmus stören. Viele der daraus abgeleiteten Empfehlungen lassen sich schon heute einfach umsetzen – etwa durch regelmäßige Aufenthalte im Freien oder eine bewusste Lichtgestaltung im häuslichen Umfeld.
Die Initiative versteht sich nicht nur als Informationsplattform, sondern auch als Impulsgeberin für gesundheitsfördernde Veränderungen – sowohl im individuellen Alltag als auch auf gesellschaftlicher Ebene. Ziel ist es, fundiertes Wissen über die Wirkung von Licht nicht nur zu kommunizieren, sondern in konkrete Empfehlungen zu übersetzen. Dies soll Menschen dabei unterstützen, ihre Lichtumgebung bewusst oder zumindest bewusster zu gestalten.
Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der praktischen Anwendbarkeit des wissenschaftlichen Konsenses. „Was bislang fehlte, war eine verlässliche Instanz, die Erkenntnisse aus der Forschung bündelt, verständlich aufbereitet und gezielt zugänglich macht – auch für jene, die über Lichtbedingungen in Bildungseinrichtungen, Kliniken oder im öffentlichen Raum entscheiden“, erklärt Prof. Spitschan. Die Initiative will hier eine Lücke schließen – mit evidenzbasierten Grundlagen für bessere Lichtentscheidungen.
Besonderen Wert legen die Initiatoren auf den interdisziplinären Ansatz. In die Arbeit fließen Perspektiven aus der Chronobiologie, Neurowissenschaft, Psychologie, Lichttechnik und Public Health ein. Getragen wird die Initiative von fünf internationalen Partnerorganisationen: der Internationalen Beleuchtungkommission (CIE), Society for Light, Rhythms and Circadian Health (SLRCH), der Daylight Academy (DLA), der Good Light Group (GLG) sowie dem Center for Environmental Therapeutics (CET). „Diese Zusammenarbeit unterstreicht, wie relevant und anerkannt das Thema auf internationaler Ebene ist.“
Dabei geht es auch um die sogenannte Translation von Grundlagenwissen: Wie lässt sich Forschung aus dem Labor in praktikable Empfehlungen für den Alltag überführen? „Wir müssen die gesamte Kette mitdenken – von der Grundlagenforschung bis zur Anwendung im realen Leben. Es reicht nicht, Dosis-Wirkungs-Beziehungen im Labor zu erforschen. Neben den Empfehlungen für Fachkreise bietet die Initiative auch alltagstaugliche Hinweise für die breite Bevölkerung. Schon einfache Maßnahmen können helfen, den eigenen zirkadianen Rhythmus zu stabilisieren – etwa durch bewusstes Nutzen von Tageslicht während der Mittagszeit oder das Abdunkeln des Schlafzimmers in der Nacht. Wir wollen wissen: Was heißt das für Menschen im Schichtdienst, in Schulgebäuden oder im Seniorenheim?“, so Spitschan.
Langfristig soll „Light for Public Health“ eine zentrale Wissensplattform werden, die Forschung, Prävention und Gesundheitspolitik miteinander verknüpft. Die 26 Kernaussagen markieren dabei den aktuellen Stand der Wissenschaft – und bilden den Ausgangspunkt für künftige Forschung. „Wir haben jetzt eine belastbare Grundlage“, so Prof. Spitschan. „Aber wir stehen erst am Anfang. Es gibt noch viele offene Fragen. Das Ziel bleibt, weiteres Wissen zu generieren, das für möglichst viele Menschen von Bedeutung ist – und genau dazu laden wir die Forschungsgemeinschaft ein.“
Zur Homepage der Rudolf Mößbauer Professur für Chronobiology & Health
Zur Homepage der Translational Sensory and Circadian Neuroscience Unit (MPS/TUM/TUMCREATE)
Zur Projektseite „Light for Public Health”
Zum Preprint „Evidence-based public health messaging on the non-visual effects of ocular light exposure: A modified Delphi expert consensus”
Kontakt
Prof. Dr. Manuel Spitschan
Rudolf Mößbauer Professur für Chronobiology & Health
Am Olympiacampus 11
80809 München
Tel.: 089 289 24544
E-Mail: manuel.spitschan(at)tum.de
Text: Bastian Daneyko
Fotos: Privat