Die Corona-Pandemie in besonderen Wohnformen für Menschen mit Behinderung – Wohnen in Gesundheit“ (WoGe2020) (2021-2022)
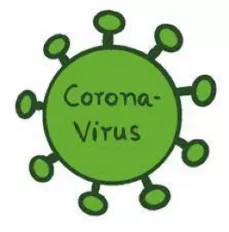
Das Projekt „WoGe2020“ erstreckt sich auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Es untersucht vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Corona-Pandemie, deren Wirkungen und Folgen auf die Wohnsituation von Menschen in Einrichtungen der Eingliederungshilfe. Dabei liegt die Aufmerksamkeit sowohl auf dem Personenkreis der Nutzerinnen und Nutzer (Menschen mit Behinderung und chronisch psychisch kranke Personen), die beim Wohnen betreut und gefördert werden, als auch auf der Gruppe des in den Wohnformen tätigen Fachpersonals. Die Feldstudie nimmt über eine bundesweite Einrichtungsbefragung den lebendigen Eindruck der Krise auf; deren Erkenntnisse fließen direkt in die anstehenden und erforderlichen Umgestaltungen bei der assistierenden und personalisierten Gesundheitssorge im Bereich der besonderen Wohnformen ein.
In Kürze startet die Erhebungsphase. In den Quartalen 3 und 4 des Jahres 2021 flankiert von einer Delphi-Studie. Informationen und Wegweisungen für die Bundesregierung ergeben sich schließlich auf der Basis vielfacher theoretischer und praxisbasierter Perspektiven.
Verantwortliche: Prof. Dr. Wacker, Elisabeth
Förderung: Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)
„b4: Bedarfe benennen | Brücken bauen | Gesundheitscampus entwickeln“

Neue Wege der kommunalen Gesundheitsförderung und Krankheitsversorgung partizipativ beobachten, bewerten, berichten (2021 – 2023)
Das Forschungsprojekt b4 begleitet das sektorenüberschreitende Kooperationsprojekt „Brückenschlag“. Dieses hat die Zielsetzung bilaterale Vorteile für die Versorgung der Patienten und die Kooperationspartner am sich verändernden Gesundheitsmarkt zu schaffen.
Es wird ein Versorgungskonzept für die Region Weilheim-Schongau entwickelt, welches die universitäre Medizin des Klinikums rechts der Isar (MRI) der Technischen Universität München und die regionalen medizinischen Versorgungsstrukturen (ambulant; stationär, rehabilitativ, präventiv) im Landkreis eng miteinander verknüpft.
Das qualitative Wissenschaftsprojekt erforscht dabei die Motivation der beteiligten Berufsstände, der Bevölkerung und der politischen Interessensvertreter, unter individuellen wie kollektiven Aspekten ebenso, wie die Belastbarkeit der sich partizipativ entwickelnden Strukturen zwischen dem MRI und den Gesundheitsdienstleistern der Gebietskörperschaft.
Aktuell gilt es Instrumente und geeignete Zugänge zu entwickeln, die es auch unter pandemischen Bedingungen erlauben die Erwartungen und Meinungen der Partner und der Einwohner des Landkreises in seiner Gesamtheit, so unmittelbar wie möglich in Erfahrung zu bringen.
Verantwortliche: Prof. Dr. Wacker, Elisabeth
Förderung: Lkr. Weilheim-Schongau, KH GmbH Lkr. WM-SOG
„Wohnungsleerstand wandeln. Partizipative Entwicklung neuer Konzepte zum Umgang mit un(ter)genutztem Wohnraum im Landkreis Dachau“ (WohL) (2019-2022)

Das Projekt erstreckt sich auf das Gebiet des Landkreises Dachau im Regierungsbezirk Oberbayern. Es untersucht die Wohnsituation in den dortigen Gemeinden – im Hinblick auf mögliche (Teil-)Leerstände, den demografischen Wandel, vorhandene Infrastruktur und (geplanten) Flächenverbrauch. Das Projekt ist im öffentlichen Interesse und wird deshalb vom Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr und dem Landkreis Dachau gefördert. Im Vordergund steht, die Motive der unterschiedlichen Interessengruppen, die mit dem Wohnungsleerstand in Zusammenhang stehen, zu erfassen und zu analysieren. Darüber hinaus werden mittels partizipativer Ansätze passgenaue Änderungsstrategien entwickelt und erprobt. Am 16.09. fand der Kick-Off statt. Aktuell befindet sich das Projekt in der Erhebungsphase. In den Quartalen 2 und 3 des Jahres 2021 führen wir die Delphi-Studie durch, das Auftakttreffen dazu hat am 03.05. stattgefunden und gerade läuft die erste Befragungsstufe.
Verantwortliche: Prof. Dr. Wacker, Elisabeth
Förderung: BayStmB und Lkr Dachau
„Wohlbefinden Gestalten“ (WoGe) (seit 2019)
Das kbo Kinderzentrum der Klinik Großhadern soll ab dem Jahr 2020 umgebaut werden. Hierzu führen der Lehrstuhl für Diversitätssoziologie und der Lehrstuhl für Sozialpädiatrie (Prof. Dr. Mall) unter der Leitung von Dr. Shahin Payam das Projekt „Wohlbefinden Gestalten“ (WoGe) durch, welches das Ziel verfolgt, mit neuartigen qualitativen Methoden ein Meinungsbild der jungen bzw. jugendlichen Patientinnen und Patienten und Eltern bezüglich der Gestaltung ihrer Umgebung (insbesondere der Patientenzimmer) einzuholen. Durchgeführt wird die Studie von einem Masteranden der Sport- & Gesundheitswissenschaften.
Verantwortliche: Prof. Dr. Wacker, Elisabeth
Zusammen mit : kbo Kinderzentrum der Klinik Großhadern
QualiPEP – Qualitätsorientierte Prävention und Gesundheitsförderung in Einrichtungen der Eingliederungshilfe und Pflege
Der Lehrstuhl für Diversitätssoziologie (Verantwortlicher: Philip Bootz) hat den Auftrag übernommen, in einer Feldstudie deutschlandweit exemplarisch zu erkunden, welche gesundheitsfördernden Strukturen und Angebote in den Einrichtungen der Eingliederungshilfe bestehen, vor allem, welche Leistungen dort vom Personenkreis der Bewohner_innen benötigt und gewünscht werden. Auch die Gesundheitsförderung für das beschäftigte Personal ist dabei im Blick, um für noch offene Bedarfe an betrieblicher Gesundheitsförderung erste Einschätzungen zu erhalten. Die Feldstudie ist abgeschlossen und der Abschlussbericht vorgelegt. Die weitere Diskussion der Ergebnisse im Rahmen großer Fachkongresse hat bereits Reviews positiv durchlaufen, weitere Tagungen und Publikationen sind in Vorbereitung.
Verantwortliche: Prof. Dr. Wacker, Elisabeth
Förderung: AOK-Bundesverband (beauftragt vom Bundesministerium für Gesundheit)
SIM – Socio-Economic Integration of Migrants
Das Projekt ist Teil eines größeren Forschungsverbundes zur sozioökonomischen Integration von Migrant_innen, welcher von Prof. Dr. Susanne Elsen (Freie Universität Bozen) geleitet wird. Im Rahmen von „SIM“ führte Dr. Katharina Crepaz eine Studie zu Migrantinnenselbstorganisationen in Bayern (München und Nürnberg) durch, und erhob durch qualitative Interviews Daten zu den Voraussetzungen, Schwierigkeiten, Anforderungen und Rahmenbedingungen für erfolgreiche Selbstorganisation von Migrantinnen im Sinne eines Empowerment-Ansatzes. Abschließend wurden Best Practices identifiziert und deren Übertragbarkeit auf das Fallbeispiel Südtirol geprüft. Der Abschlussbericht wurde erfolgreich eingereicht, eine wissenschaftliche Publikation der Ergebnisse befindet sich derzeit im Reviewverfahren.
Verantwortliche: Dr. Katharina Crepaz
Förderung: Freie Universität Bozen, Italien
TRANS-DISAB – Bewältigung der Herausforderungen einer erfolgreichen Transition von jungen Erwachsenen mit Behinderung: Teilhabe, Gesundheit und Lebensqualität im Lebensspannenansatz (2017-2020)
Mitwirkung an einer Längsschnittstudie (SPARCLE-Studie) bezogen auf den Übergang in das junge Erwachsenenalter von einem wachsenden Personenkreis mit lebenslanger Beeinträchtigung in der Lebensspanne. Die konzeptionellen Entwicklungen des 21. Jahrhunderts der Weltgesundheitsorganisation erfordern neue Erkenntnisse bezogen auf die Wirkungen physischer, sozialer und kontextbezogener Einflussfaktoren. Dies wird erfasst und bewertet mit Fokus auf Lebensqualitätsmaßstäbe. Dabei fließen partizipative Verfahren ein, die die medizinische Perspektive nach der ICF (International Classification of Functioning der WHO, 2001) ergänzen. Ein Startkongress und ein Wissenschaftlicher Workshop haben stattgefunden, derzeit ist eine Publikation eingereicht.
Verantwortliche: Prof. Dr. Wacker, Elisabeth
Förderung: DFG | Kooperationsprojekt mit der Universität zu Lübeck sowie dem Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Klinik für Kinder- und Jugendmedizin
Bundesweite Studie zum Thema „Qualitätsorientierte Prävention und Gesundheitsförderung in Einrichtungen der Eingliederungshilfe und Pflege“
Im Jahr 2015 hat der Bundesgesetzgeber das Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention in Kraft gesetzt (Präventionsgesetz). Die damit gewünschten neuen Leistungen zur gesundheitlichen Prävention und Gesundheitsförderung sollen alle Menschen erreichen. Sie sollen auch bei dem Personenkreis, der in bzw. über Einrichtungen der Eingliederungshilfe betreut wird, wirksam werden (hier: im Bereich teil- und vollstationäres Wohnen).
Das Bundesministerium für Gesundheit hat im Jahr 2017 den AOK-Bundesverband beauftragt, ein Qualitätssicherungskonzept zum Präventionsgesetz zu entwickeln. Dazu sollen Qualitätskriterien erarbeitet werden, nach denen die finanziellen Mittel vergeben werden, die wie im Präventionsgesetz festgelegt fließen sollen. Im Rahmen dieses Forschungsprojektes „Qualitätsorientierte Prävention und Gesundheitsförderung in Einrichtungen der Eingliederungshilfe und Pflege“ (kurz: QualiPEP) soll zudem ein Rahmenkonzept entstehen zur Förderung der Gesundheitskompetenz sowie Ansätze zur qualitativen Weiterentwicklung der betrieblichen Gesundheitsförderung.
Im Rahmen dieser Studie hat der Lehrstuhl für Diversitätssoziologie den Auftrag übernommen, in einer Feldstudie deutschlandweit exemplarisch zu erkunden, welche gesundheitsfördernden Strukturen und Angebote in den Einrichtungen der Eingliederungshilfe bestehen, vor allem aber, welche Leistungen dort vom Personenkreis der Bewohnerinnen und Bewohner benötigt und gewünscht werden. Auch die Gesundheitsförderung für das beschäftigte Personal soll in den Blick genommen werden, um für noch offene Bedarfe an betrieblicher Gesundheitsförderung erste Einschätzungen zu erhalten.
Die Feldstudie legt eine „Diagonale durch Deutschland“, die sowohl verschiedene Einrichtungstypen (fachliche Ausrichtungen), als auch unterschiedliche Träger, Dimensionen und Umgebungen der Einrichtungen (städtisch/ländlicher Raum) enthält. Der besondere Fokus liegt darauf, dass alle Personengruppen der Eingliederungshilfe zu Wort kommen können. Die Form der Beeinträchtigung und der gesundheitliche Zustand wird bewusst durch ein heterogenes Sample abgebildet. Auch Bewohnerinnen und Bewohner werden einbezogen, die sich ausschließlich über Fremdauskünfte (proxy interviews) beteiligen können. Wir freuen uns auf spannende Erkenntnisse.
Verantwortlicher: Philip Bootz
Medizinische „Problemgruppen“: Zwischen Pathologisierung und Neurodiversität
Die als psychische Beeinträchtigungen oder neuronale Entwicklungsstörungen klassifizierten Zustände der „Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung“ (ADHS) und der „Autismus-Spektrum-Störung“ (ASS) können als „sozio-medizinische Störungen“ (Dumit 2000) aufgefasst werden, die durch die Beobachtung sozial abweichender Verhaltensweisen bestimmt werden. Trotz „erfolgreicher“ Medikalisierung bleiben diese Krankheitsdiagnosen umstritten und Betroffene verstehen sich ungeachtet medizinischer Labels nicht einfach als „krank“. Die Neurodiversitäts-Bewegung etwa zielt im Gegenteil auf eine De-Medikalisierung ab und will ADHS, ASS und andere kognitive Eigenschaften als Verschiedenartigkeit ohne Krankheitswert verstanden wissen. Andere Patientenvertretungen hingegen kämpfen für die öffentliche Anerkennung der Krankheitsbilder und eine bessere medizinische Versorgung. Zentral ist dabei die Beobachtung, dass die Betroffenengruppen dem framing als Problemgruppe nicht passiv gegenüber stehen, sondern als „moralische Unternehmer“ (Becker) aktiv werden. Das Forschungsprojekt verfolgt das Ziel, mit der Dimension der Neurodiversität eine bislang wenig beachtete Diversitätsdimension an der Schnittstelle von Körper-, Medizin- und Diversitätssoziologie anzuvisieren. Dabei wird danach gefragt, wie die soziale Herstellung medizinischer Problemgruppen verläuft und welche Rolle medizinische und öffentliche Diskurse aber auch Selbstkontextualisierungsprozesse spielen, bzw. wie diese sich gegenseitig beeinflussen.
Verantwortlicher: Dr. Fabian Karsch
Diversität, Identität, und politische Partizipation im europäischen Mehrebenensystem: Politische Partizipation von Menschen mit Beeinträchtigung in Deutschland und Italien
Kerngebiet des Forschungsinteresses sind verschiedene Ausprägungen gesellschaftlicher Diversität (z.B. Menschen mit Beeinträchtigung, Angehörige nationaler Minderheiten, Menschen mit Migrationshintergrund), die aus Diversitätsaspekten resultierenden Konstruktionen von individueller und kollektiver Identität und der Wunsch nach politischer Partizipation, um am Policy-Making Prozess teilnehmen und Einfluss auf relevante Politikbereiche ausüben zu können. Innerhalb dieses theoretischen Frameworks verortet sich auch das Forschungsprojekt zur politischen Partizipation von Menschen mit Beeinträchtigung. Als Fallstudien dienen Deutschland und Italien, mit besonderem Regionalfokus auf Bayern und Südtirol, da politische Partizipation auf regionaler Ebene niedrigschwelliger ablaufen kann und als „näher“ am täglichen Leben wahrgenommen wird. Es werden sowohl „top-down“ (rechtliche und sozialpolitische Rahmenbedingungen, politische Parteien, Institutionen) als auch „bottom-up“ (Zivilgesellschaft, Vernetzung) Prozesse analysiert; 2018 finden in beiden Fallstudien Landtagswahlen statt, was einen besonders interessanten Rahmen für komparative Forschung darstellt. Die Datenerhebung soll Großteils 2018 im Vorfeld der Wahlen erfolgen, der Abschluss des Projektes ist für 2020 geplant.
Verantwortliche: Dr. Katharina Crepaz
Digital Health: Neue Wissensverhältnisse der Gesundheit
Gesundheit ist zu einem gesellschaftlichen Zentralwert und auch einem individuellen Handlungsziel geworden, das einer Machbarkeitsvision folgt und damit ein neues Maß an Selbstverantwortlichkeit und Kompetenzen einfordert. Die zentrale Hypothese lautet, dass sich mit der Digitalisierung einerseits und dem Bedeutungszuwachs der Gesundheit in allen Lebensbereichen andererseits, eine Transformation gesundheitlicher Wissensverhältnisse vollzieht. Diskursive Wissensbestände und materielle Dispositive der Gesundheitsförderung und der Prävention werden als Triebfedern gesundheitsbezogener Praktiken wirksam, die in unterschiedlichen Handlungsfeldern je unterschiedliche gesundheitsbezogene Subjektivierungsweisen hervorbringen. Vor diesem Hintergrund untersucht das Forschungsprojekt, ob die technisch angeleitete und selbstgesteuerte Messung von Gesundheits- und Körperdaten im Sinne der Gesundheitsförderung tatsächlich zu einem Autonomiegewinn führt oder eher zu neuen Formen präsymptomatischer Medikalisierung beiträgt.
Verantwortlicher: Dr. Fabian Karsch
DAAD-Quality Network Biodiversity Kenya (2016-2020): Reconciling human livelihood needs and nature conservation; main collaborators (Prof. Jan Christian Habel, Lehrstuhl für Terrestrische Ökologie, TUM)
Zusammen mit: TUM, Terrestrial Ecology Research Group; Pwani University; Taita Taveta University; South Eastern University