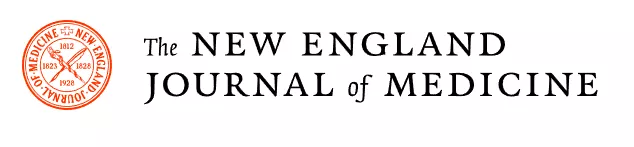Bei rund 80.000 Menschen in Deutschland ist die Nierenfunktion so stark eingeschränkt, dass sie sich mehrmals wöchentlich einer Dialyse unterziehen müssen. Betroffene leiden oft an zusätzlichen Gesundheitsproblemen wie Diabetes und Herzerkrankungen – entsprechend ist sportliche Betätigung bei den meisten Patient_innen kaum noch möglich. An diesem Missstand setzte die großangelegte Studie eines Konsortiums unter der wissenschaftlichen Führung von Prof. Dr. Martin Halle, Ordinarius des Lehrstuhls für Präventive und Rehabilitative Sportmedizin, an.
Das Projekt wurde vom Innovationsfonds der Krankenkassen mit rund 5,2 Millionen Euro gefördert und unter dem Titel „Exercise during Hemodialysis in Patients with Chronic Kidney Failure" im renommierten „New England Journal of Medicine Evidence" (NEJM Evid) veröffentlicht.
Knapp 1.000 Patient_innen in 21 deutschen Dialysezentren haben an der Studie teilgenommen. „Damit haben wir eine der weltweit größten Studien zu sportlicher Aktivität bei erkrankten Patient_innen auf die Beine gestellt“, erklärt Prof. Halle und ergänzt: „Die hohe Anzahl an teilnehmenden Patient_innen – es waren fast 60 Prozent aller Dialysepatient_innen – zeigt, dass diese auch offen dafür sind, so ein Training durchzuführen.“ Ein Abgleich mit Daten von Krankenversicherungen ergab, dass die Zusammensetzung der Teilnehmenden in Bezug auf Aspekte wie Alter, Geschlecht und Gesundheitszustand repräsentativ für die Dialysepatient_innen in Deutschland war.
Die teilnehmenden Patient_innen erhielten über einen Zeitraum von zwölf Monaten mindestens ein- und maximal dreimal die Woche ein körperliches Training, während die Kontrollgruppe ausschließlich medizinisch betreut wurde. Das Training beinhaltete 30 Minuten Ausdauerübungen mit einem Ergometer und weitere 30 Minuten Übungen mit Gewichten, elastischen Bändern oder Bällen – entsprechend an die individuellen Möglichkeiten der Patient_innen angepasst.
Der Gesundheitszustand und damit auch die Lebensbedingungen der Teilnehmer_innen hatte sich nach einem Jahr stark verbessert. Einfache Tests, wie beispielsweise aus dem Sitzen aufzustehen oder Sechs-Minuten-Strecken zurückzulegen, bestätigen die Ergebnisse: „Wir wollen, dass sich die Patient_innen zu Hause versorgen können und nicht in Altenheime müssen. Durch unsere Tests zeigte sich, dass die Lebensqualität gestiegen ist. Die Patient_innen konnten beispielsweise selbstständig zum Bäcker gehen oder Freunde besuchen“, zeigt sich Prof. Halle erfreut.
Ein weiteres Zeichen für die positiven Auswirkungen des Trainings: Die Zahl der Tage, die Teilnehmende innerhalb des Studienzeitraums im Krankenhaus verbrachten, war mit einem regelmäßigen Training nur halb so hoch wie in der Kontrollgruppe – im Durchschnitt zwei Tage statt fünf.
„Für mich sprechen die Ergebnisse eine deutliche Sprache“, sagt Martin Halle. „Mit vergleichsweise geringem Aufwand können wir die Gesundheit der Betroffenen verbessern und zudem Kosten für das Gesundheitssystem senken.“ Nach Berechnungen der Forschenden lägen diese für ein individualisiertes Training ungefähr bei 25 Euro pro Trainingseinheit und Person, wohingegen ein täglicher Krankenhausaufenthalt mit knapp 1.000 Euro zu Buche schlägt.
Den Abschlussbericht zu der Studie, hat das Konsortium DiaTT (Dialyse Trainings-Therapie) dem Gemeinsamen Bundesausschuss der Krankenkassen überreicht. In diesem Gremium wird schließlich darüber entschieden, ob Training während der Dialyse zu einem Angebot für alle Versicherten wird. „Ich hoffe, dass unser Trainingsprogramm zur Kassenleistung wird“, sagt Martin Halle. „Unsere Studie zeigt, wie wichtig ein ganzheitlicher Blick auf Gesundheit gerade bei alten und gebrechlichen Patienten ist. High-Tech-Medizin ist wichtig, ihr volles Potenzial kann sie aber nur in Kombination mit anderen Feldern wie der Präventionsmedizin erreichen.“ In den kommenden Jahren sollen die Studienteilnehmer_innen weiter begleitet werden, um mehr über die Effekte eines langfristigen Trainings in Erfahrung zu bringen.
Auch für die Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaften in Zusammenarbeit mit der Medizin sieht Prof. Halle in solchen Projekten einen wichtigen Anschlusspunkt für zukünftige Vorhaben: „Wenn Sport, Gesundheit und Medizin zusammenfinden – und vor allem zusammenarbeiten –, dann kann sich Neues entwickeln, wie unser Studienbeispiel aufzeigt. Wir sollten diese Schnittstellen nutzen, um langfristig neue Strategien zu entwickeln“, erklärt der ärztliche Direktor des Lehrstuhls für Präventive und Rehabilitative Sportmedizin.
Zur Homepage des Lehrstuhls für Präventive und Rehabilitative Sportmedizin
Zur Studie "Exercise during Hemodialysis in Patients with Chronic Kidney Failure"
Kontakt:
Prof. Dr. Martin Halle
Lehrstuhl für Präventive und Rehabilitative Sportmedizin
Georg-Brauchle Ring 56
80992 München
Tel.: 089 4140 6774 (Klinikum rechts der Isar)
Tel.: 089 289 24441 (Uptown Campus)
E-Mail: Martin.Halle(at)mri.tum.de
Text: CCC/Paul Hellmich/Bastian Daneyko
Fotos: New England Journal of Medicine Evidence/privat